| Mennoniten-Plautdietsch — eine Sprache wandert durch die Welt |
| 1517 veröffentlichte
Luther seine 95 Thesen an der Schloßkirche zu Wittenberg. Sie richteten
sich gegen den Ablaß und gegen das unchristliche Treiben der Geistlichen
in der katholischen Kirche. In dieser Zeit sagten sich aus gleichem Grunde
drei Zwingli Schüler in der Schweiz von der katholischen Kirche los.
Sie wollten wieder streng nach Gottes Worten und den Geboten der Bibel leben
und lehnten jeden Luxus, den Eid und den Kriegsdienst ab. Statt der Kindertaufe
forderten sie die Erwachsenentaufe. Jeder Mensch sollte selbst entscheiden,
welcher Kirche er angehören wolle.
Die Schweizer Brüder, wie sie sich fortan nannten, fanden mit ihren
neuen Glaubensregeln beidseitig des Rheins, von der Schweiz bis in die
Niederlande regen Zulauf. Anders als die Lutheraner, die durch mächtige Fürsten von den Angriffen der katholischen Kirche geschützt wurden, waren die Wiedertäufer den Drangsalen der katholischen Kirche gnadenlos ausgeliefert. Sie wurden gehetzt , vertrieben und ermordet, wo immer sich Knechte der Schwarzröcke, als Handlanger bereit fanden, die heiligen Werte des Christentums außer Kraft zu setzen. *** Nur der friesische Graf Edzart war ihnen zugetan und bot ihnen zunächst
Schutz. Der Zustrom der Verfolgten nach Friesland war groß. Der Lebensraum
wurde eng. Graf Edzart starb und sein Nachfolger gab dem Druck der katholischen
Kirchenmänner nach. So wurde 1530 ein Edikt erlassen. Es besagte,
daß alle Wiedertäufer bis Faßnacht Friesland zu verlassen
hätten. Andernfalls drohe die Todesstrafe. Fünf Jahre später
wurde die Erwachsenentaufe verboten. Diese Gesetze wurden zwar nie konsequent
angewandt. Nur die führenden Köpfe der Abweichler wurden als
Anführer gnadenlos verfolgt. *** Mehrere Pestepidemien und der Einfall der Hussiten hatten das Land zwischen Danzig und Elbing nahezu entvölkert. Das Oberland war kaum noch bewohnt, und im Unterland, die Inseln, die Werder, im Delta der Weichsel und Nogat, einst fruchtbares Ackerland, waren die Deiche wegen mangelnder Pflege an vielen Stellen gebrochen und die Ländereien nach häufigen Überschwemmungen zum Teil versumpft. Der Regent Herzog Albrecht von Preußen hatte schon im Jahre 1527 Holländer auf einem 3400 ha großen Areal angesiedelt, die das Land bewirtschaften sollten. Die Mennoniten schätzte er als ehrliche und fleißige Leute. Zudem waren sie versierte Deichbauer. Er versprach ihnen die Wehrfreiheit, eigene Schulen, Kirchen und eine eigene Verwaltung. Dafür sollten sie die Deiche erneuern, die Ländereien trocken legen und das gewonnene Land als Eigentum erhalten. In den Jahren 1540 - 1550 reisten die ersten Mennoniten von Friesland nach Westpreußen und kultivierten unter großen Entbehrungen die Werder. Auf dem Neuland gründeten sie Dörfer. Mehrere Dörfer bildeten eine Kolonie. Selbst gewählte Ältermänner und Prediger lenkten die Gemeinden und vertraten sie nach außen. Aber sie schlichteten auch Streitigkeiten unter den Dorfbewohnern, und gaben Ratschläge, die man annehmen und achten mußte, wenn man nicht als Widerspenstiger aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden wollte. Lebten sie auch als Brüder in der Gemeinschaft, so waren sie doch unterschiedlich begütert. Ideologien der Gleichmacherei waren ihnen fremd. Bauern waren Bauern, Knechte blieben Knechte. Doch kein Mennonit durfte zum Bettler werden. Sie unterhielten Armenhäuser, die von der Gemeinschaft getragen wurden und sie gründeten die erste Feuerversicherung. In ihren Schulen und Kirchen wurde hochdeutsch gesprochen. Ihre Umgangssprache
zu Hause und auf den Straßen war jedoch ein vom Friesischen geprägtes
Plattdeutsch, aus dem sich später das Plautdietsch, als eine Westpreußische
Mundart entwickelte. In der Abgeschiedenheit der Werder war es den Mennoniten dann auch fast
150 Jahre vergönnt, unbehelligt von äußeren Anfeindungen
als religiöse Gruppe in Westpreußen zu leben. Nur als einige
Handwerker und Gewerbetreibende versuchten, außerhalb ihrer Gemeinschaft
nach Arbeit und Brot zu suchen, wurden sie wegen ihres Fleißes schnell
zu Außenseitern. So klagten 1570 die Elbinger (wahrscheinlich waren
es die Zünfte), daß die Mennoniten ihnen das Brot wegnähmen
und beschimpften sie als Verderber des gemeinsamen Lebens. Im Jahre 1582
muß es dann zu weiteren Beschuldigungen gekommen sein. In einem
Brief an den Danziger Rat beteuerten sie, daß sie seit 30 Jahren
friedlich im Lande lebten und niemals wegen ihres Glaubens belästigt
worden seien. Aber sie seien keine Aufrührer. Dank ihres Fleißes und ihres bescheidenen Lebens, erarbeiteten sie sich privat und als Gemeinschaft beachtliche Rücklagen, die für Gemeinschaftsaufgaben und weitere Landkäufe gedacht waren. Denn die Mennoniten waren meist kinderreich. Jedem Sohn nach Möglichkeit den Grundstein für das bäuerliche Erwerbsleben zu schaffen, erachteten sie als ihre Pflicht. Doch wer Geld hat, hat auch Neider. So beschloß der Elbinger Rat
im Jahre 1700, daß die Mennoniten, für die Wehrfreiheit ein
Schutzgeld zu zahlen hätten. *** Mit der Zeit wurde das Siedlungsland in der näheren Umgebung knapp und es war kaum noch etwas zu erwerben. Daraufhin pachteten sie große Ländereien von den umliegenden Großgrundbesitzern, die ihre Güter herunter gewirtschaftet hatten. Doch kaum hatten sie den Boden nach schwerer Arbeit ertragreich gemacht und gute Ernten erzielt, wurde die Pacht erhöht und die Pachtzeit verkürzt. Zugleich forderte auch der Staat einen unangemessenen Anteil vom Lohn ihrer Arbeit. Sie mußten für das gepachtete Land doppelt so viel Steuern zahlen, wie die angrenzenden Lutheraner. Doch, bei allen Repressalien kam es im allgemeinen nie zu Hetzjagden und Verfolgungen. Sie wurden angefeindet, geduldet und ausgenutzt. *** 300 Jahre unterstand Westpreußen mit seiner überwiegend deutschen Bevölkerung der polnischen Krone. 1770 fielt es an Preußen. 1774 lebten nach einer Zählung 13500 Mennoniten in Westpreußen. Nach der Übernahme des Landes verfügten die Preußen sogleich, daß die Mennoniten, für die Befreiung von der Wehrpflicht jährlich eine Summe von 5000 Talern an die Kadettenschule in Kulm zu zahlen hätten. Ein wenig aufatmen konnten sie 1780, als Friedrich der Große ihnen die ewige Befreiung vom Kriegsdienst, die Religionsfreiheit und den Schutz ihrer Betriebe zusagte. Aber nicht, weil er den Mennoniten freundlich gesinnt war, sondern weil sie als Steuerzahler für seine Kriegskasse nützlicher waren, als Soldaten. Doch schon unter seinem Nachfolger Friedrich Wilhelm II., der ab 1786 regierte, wurden ihre Rechte erneut gestutzt. Fortan sollten nur die Mennoniten vom Wehrdienst befreit sein, die auf geerbtem Grund lebten. Die aber, die auf gekauften Grund siedelten, sollten Wehrdienst leisten. Das aber wollten die Ältermänner und Prediger, nicht hinnehmen. *** Für das Versprechen von keiner Staatsmacht bevormundet zu werden, hatten ihre Vorfahren alle Mühen und Entbehrungen auf sich genommen und aus dem versumpften Land fruchtbare Äcker gemacht. Sie hatten die Anfeindungen und Repressalien der Kirchen ertragen und sie hatten die maßlosen Forderungen der Staatsmacht über sich ergehen lassen. Im 30-jährigen Krieg hatten die Schweden sie überfallen. Die hatten ihre Deiche durchstochen. Es hatte Überschwemmungen gegeben, viele Glaubensbrüder waren ertrunken, andere hatten nur das nackte Leben gerettet. Viele wurden auch niedergemetzelt — ohne Gegenwehr. Töten vorbot ihnen ihr fester Glaube. Immer wieder haben sie sich geduckt und gezahlt, so lange sie einen Weg sahen, sich damit die religiöse Freiheit zu erhalten. Nun lag es auf der Hand, daß die Wehrpflicht, die heute für Neusiedler gelten sollte, schon morgen für alle gelten würde. Und damit währen die Fundamente ihres Glaubens unterspült. Das aber wollten sie nicht hinnehmen. Wo gab es da einen Ausweg. Besitz bedeutete ihnen wenig, der Glaube alles. Im Rückblick waren ihre Sorgen übertrieben. Noch dreißig Jahre später, im Befreiungskrieg 1813-15 konnten sich die Mennoniten vom Wehrdienst freikaufen. Erst nach den Siegen über Österreich und Dänemark hatten sie als Trainsoldaten oder Sanitäter waffenlosen Dienst zu leisten. *** In dieser Zeit, Katharina II. regierte in Rußland, hatten die Russen
die Türken im südlichen Rußland zurück gedrängt.
Die eroberten Gebiete waren fast menschenleer. Es war umstands- und zeitbedingt, daß sich im Laufe der Jahre immer wieder junge Leute außerhalb der Kolonien nach einem Auskommen umsehen mußten. Wohl blieben sie fromme, achtenswerte Mennoniten, doch ihre Ansichten zum Leben entfernten sich mehr und mehr von der entsagenden Lebensweise ihrer Glaubensbrüder auf den weltabgeschiedenen Werdern. Sie lehnten nicht mehr alle Dinge ab, die das Leben angenehmer und leichter machten. Sie wehrten sich weniger, wo staatliche Gesetze einzelne Pfeiler ihres Glaubens unterhöhlten. Dieses Abnabeln einzelner Gruppen, von den festgefügten Lebensweisen jener, die jede Änderung ablehnten, zieht sich dann auch wie ein roter Faden durch die Geschichte der Mennoniten. *** 1788 reisten die ersten vier Familien über Riga, durch die Ukraine nach Südrußland. Weitere 18 Familien folgten im gleichen Jahr. Es waren meist arme Leute, Handwerker, Tagelöhner und Knechte, die innerhalb der festgeschlossenen Kolonien gelebt und nun als Neusiedler auf eigenem Grund und Boden hofften. Ihr erstes Siedlungsgebiet war Chortitza, eine unbewohnte Insel im Dnjepr,
12 Km lang und 3 -4 Km breit — heute ein Stadtteil von Saporoshje. Als
sie dort ankamen, war es später Herbst. Es gab kein Haus, kein schützendes
Dach auf der Insel. So verlebten sie den ersten Winter in eilig gebauten
Erdhütten. Sicherlich leidvolle Tage, Wochen und Monate. Schon 35 Jahre später gab es 13 Dörfer, mit 314 Voll- Halb- und Kleinwirtschaften auf der Insel. Hinzu kamen Handwerker und Tagelöhner mit etwas Vieh. Anzunehmen ist, daß in dieser Zeit weitere Familien zugewandert sind. Aber die Zahlen sagen auch wie schnell die Bevölkerung zu nahm. Wie schon in Westpreußen, lag auch hier das Wohl der neugegründeten
Kolonien in den Händen der gewählten Ältermänner und
Prediger. In den Kirchen und Schulen sprachen sie hochdeutsch, und Religion
blieb das Hauptfach in der 6-jährigen Schulzeit. Zu Hause, auf den
Straßen und in den Dörfern aber sprachen sie weiterhin das
Plautdietsch, wie sie es in Westpreußen gesprochen hatten. Die Sprache
zu pflegen und zu erhalten war Anliegen der Prediger und Ältermänner.
War sie doch ein festes Bollwerk gegen die Einflüsse und den Verlockungen
der sie umgebenden fremden Kultur. Ihr Ziel war Molotschna, dort am Ufer eines kleinen Flusses, der in das
Asowsche Meer fließt, sollten sie siedeln. 152 Familien gründeten dann im folgenden Frühjahr die Kolonie Molotschna. Später kamen 162 Familien hinzu. *** In den abgeschiedenen Dörfern Chortitzas lebten die Menschen auch weiterhin unter dem alles bestimmenden Einfluß der Prediger und Ältermänner, die nicht an den Grundsätzen ihres Glaubens rütteln ließen. Die Worte der Bibel war ihnen Gebot, arbeiten und beten war ihr Alltag, Luxus und Frohsinn war verwerflich. Daneben hatte sich aber auch eine Gemeinschaft auf der Insel entwickelt,
die man mit Abstrichen als kleinstädtisch bezeichnen konnte. In ihr
lebten Handwerk und Gewerbe. Es gab Mühlen, Ziegeleien und Fabriken
für landwirtschaftliche Geräte. So wurde der erste Mähdrescher
Rußlands von Mennoniten entwickelt und gebaut. *** Schon bald reichte das ursprünglich zugewiesene Siedlungsland in Chortitza und in Molotschna nicht mehr aus. Neues Land wurde gebraucht, und sie fanden es in den Steppen der nahen und fernen Umgebung. Eine bedeutende Kolonie, die mehrere größere Orte umfaste, gründeten sie in Neu Samara an der Wolga, gut 800 Km nordöstlich von Molotschna und gut 1000 Km ostsüdöstlich von Moskau, gelegen. Knapp hundert Jahre lebten die Glaubensbrüder in diesen Gebieten unbehelligt von der Staatsmacht, wie ein Staat im Staate. Sie zahlten ihre Abgaben, wo immer sie gefordert wurden. Ansonsten lebten sie nach den selbst gegebenen Gesetzen innerhalb ihrer Kolonien. Sie besaßen eigene Schulen und Kirchen und pflegten ihre Sprache, das Plautdietsch, als Schutzschild gegen unliebsame Einflüsse von außen. Dabei konnte es durchaus passieren, daß in dem einen Ort etwas erlaubt war, was andernorts noch verboten war. 1871 jedoch, der König Wilhelm von Preußen wurde in Versailles
zum Kaiser gekrönt, wurde den Mennoniten in Rußland das Selbstbestimmungsrecht
genommen. Sie, die sich noch immer als Deutsche fühlten, sollten
nun Russen werden und ihre Kinder auf russische Schulen schicken. Drei
Jahre später, galt auch die Befreiung von der Wehrpflicht nicht mehr. Für die Menschen jedoch, die kaum ein Leben außerhalb der Kolonien kennen gelernt und um ihres Seelenheiles willen bewußt alle fremden Lebensweisen abgelehnt hatten, waren die Lehren der Bibel und die Grundsätze ihres Glaubens: kein Luxus, kein Eid, keinen Kriegsdienst, sowie eigene Schulen und Kirchen, noch immer höchstes Gebot. Die sollte keine weltliche Macht vom Thron stoßen. *** In dieser Zeit waren die Regierungen in den Vereinigten Staaten und in Kanada noch immer bestrebt Einwanderer in den dünnbesiedelten Weiten der Prärien anzusiedeln. Schon 1864 hatten in Steinbach, südlich von Winnipeg, aus Europa eingewanderte Mennoniten 65 Hektar Land pro Familie kostenlos erhalten. Sie schätzten die Mennoniten als fleißige Bauern. Eine Abordnung, der in Rußland Bedrängten reiste in die USA und nach Kanada, um nach neuen Siedlungsmöglichkeiten zu suchen. Die Regierung in Ottawa war bereit den Einwanderern Glaubensfreiheit, Befreiung vom Wehrdienst, eigene Schulen und Kirchen, sowie eigene Verwaltungen zu gewähren. In der folgenden Zeit reisten 13000 Mennoniten in die USA und 8000 nach Kanada. Für die Wahl des Zielorts waren wahrscheinlich alte Familienbande ausschlaggebend. Für die Überfahrt und den Neuanfang der Einwanderer sammelten allein die Glaubensbrüder in den USA 100000 Dollar. *** Der größte Teil, der ersten Rußlandflüchtlinge, die in Kanada eine neue Heimat fanden, kamen aus Chortitzas ländlichen Kolonien. In Kanada gründeten sie neue Dörfer, in denen abermals selbst gewählte, meist sehr konservative Ältermänner und Prediger bestimmten was Recht und gottgefällig für die Glaubensbrüder war. Wohl gab es einzelne Stimmen, die wünschten, daß die Kinder in ihren Schulen nun auch englisch lernen sollten, um ihnen ein leichteres Einleben und Fortkommen im Lande zu ermöglichen. Die Prediger aber lehnten es ab. Würden die Kinder nun auch noch englisch lernen, wäre ihnen damit ein Tor geöffnet, das zum Ausbrechen aus dem streng geregelte Leben in den Kolonien, einlud. Nein, sie beharrten auf den alten Grundsatz: Sieben Jahre gehört
das Kind der Mutter, sechs der Schule und sieben dem Vater. Die Landwirtschaft
war ihr Brot und der Vater war auf die Arbeitskräfte seiner Kinder
angewiesen. Die große Masse, der in Rußland verbliebenen Mennoniten, leistete dann auch den Wehrdienst, meist aber nur Ersatzdienst. Und, wo es unumgänglich war, schickten sie ihre Kinder auf russische Schulen. Ansonsten lebten sie ihr Leben wie gewohnt. *** Im ersten Weltkrieg, noch unter der Regierung des Zaren, wurden alle Gesetze abgeschafft, die den Mennoniten ein Eigenleben im Staat gestatteten. Sie sollten ohne Ausnahmen russische Untertanen werden. Unter den folgenden Revolutionsregierungen mußten sie dann erste Plünderungen und Erniedrigungen von noch halbwüchsigen Bolschewiken ertragen. Unter Stalin wurde ihnen jeder Besitz genommen und alle Kolonien im Süden Rußlands wurden aufgelöst. Es folgte die Zwangsumsiedlung nach Kasachstan. In dieser Zeit waren sie recht- und schutzlos den wütenden Rotarmisten ausgeliefert. Sie wurden geschlagen und ermordet, Hunger und Krankheiten brachten Leid und Tod. Brauchbare Arbeitskräfte wurden willkürlich verhaftet und in ein Arbeitslager gebracht. Die Spuren der Deportierten verloren sich in den Weiten Sibiriens. Väter und Söhne blieben für die Angehörigen für immer verschollen. Nur wenige haben diesen Leidensweg überlebt. In diesem Chaos fanden noch einmal 21000 Mennoniten in Kanada eine Zuflucht. Es gibt viele Schreiben, die von der Not während der Reise erzählen.
So heißt es in einem Bericht: Viele Tage wurden wir in Moskau aufgehalten.
Da mußten wir viele Schikanen der Bürokraten ertragen, bis
wir endlich die nötigen Ausreisepapiere erhielten. Mit der Bahn fuhren
wir von dort nach Riga, dann weiter mit einem Schiff nach Hull. Im Kaiser
- Wilhelm - Kanal mußte das Schiff Kohlen bunkern. Während
der Liegezeit in Holtenau kamen Ortsansässige an Bord, die ihr Obst
verkaufen wollten. Wir hätten auch gerne ein paar Äpfel gehabt,
hatten aber kein Geld um welche zu kaufen. Von Hull ging die Reise über
Land nach Liverpool und von dort weiter mit dem Schiff nach Kanada. In einem anderen Schreiben heißt es: 'Im Oktober 1924 verließen wir Podolsk (Samara). Mit Pferd und Wagen ging es zur nächsten Bahnstation. Von dort fuhren wir mit weiteren drei Familien vier Tage in einem doppelstöckigen Güterwagon über Moskau nach Riga.' (Man möge sich vorstellen: Im Oktober im Grenzland zu Sibirien in einem doppelstöckigen Güterwagon zu reisen, in dem sie nicht einmal die nötige Stehhöhe hatten . Es wird schon kalt gewesen sein. Dazu keine Heizung, keine sanitären Anlagen.) 'In Riga verlebten wir drei Tage in einer Notunterkunft. Danach gingen wir an Bord eines Schiffes, das uns nach London brachte. Von London fuhren wir mit dem Zug nach Southampton und von dort mit dem Schiff nach Quebec, wo wir am 18. November ankamen. Während der Weiterfahrt nach Saskatchewan wurden wir von der Mennonitische Kommission für Einwanderer betreut, die uns dann auch bei der Suche nach neuem Siedlungsland half.' *** Als der Boden südlich von Winnipeg knapp wurde, fanden sie, von der Regierung gefördert, neues Land in Alberta und Saskatchewan. Beide Staaten waren noch Niemandsland. Die USA und Kanada waren gleichermaßen bestrebt ihre Hoheitsrechte auf diese Gebiete auszudehnen. Vorerst aber galt es sie zu besiedeln, um später Rechtsansprüche geltend machen zu können. Nach einem Streit mit den USA fielen dann 1905 beide Staaten an Kanada. *** In den Jahren nach dem ersten Weltkrieg waren die Deutschen in Kanada verfemt, und die Mennoniten galten als deutsche Einwanderer. Auch als Pioniere hatten sie ihre Schuldigkeit getan. Die Besítzansprüche waren geregelt, die großen weiten Ländereien waren weitgehend erschlossen. Nun sollten sie gehorsame Staatsbürger werden, den Wehrdienst leisten und ihre Kinder auf eine staatliche Schule schicken. Das aber war abermals ein Angriff auf das Glaubensfundament der Altkolonisten. (So nannte man inzwischen die Strenggläubigen, die auch hier in Kanada ein Dasein fortführten, wie sie es vorher in den entlegenen Dörfern Chortitzas gelebt hatten. Die Zuwanderer aus Molotschna nannte man hingegen: die Neukolonisten. Diese Bewertung der neuen Rußlandeinwanderer, weist auch deutlich darauf hin, wie unterschiedlich die einzelnen Gruppen inzwischen dachten und lebten.) Eiligs schickten die Altkolonisten zwei Abgeordnete nach Ottawa, die an die einst gegebenen Rechte erinnern sollen. Dort aber ernteten sie nur Hohn und Unverständnis. Die Schulgesetze, erhielten sie zur Antwort, seien Ländersache, auf die die Zentralregierung keinen Einfluß habe. Selbst als die Delegierten drohten, ihre gesamte Wirtschaftsmacht, die in ihrem Siedlungsgebiet nicht unerheblich war, dem Staat zu entziehen, bedachte man sie nur mit Spott. So kehrten sie ohne Ergebnisse zurück. Wieder fühlten sich vor allem die Altkolonisten genötigt nach möglichst entlegenen Gebieten zu suchen, in denen sie von der Landwirtschaft leben konnten und von keiner staatlichen Macht bevormundet wurden. Und sie fanden sie zunächst in Mexiko und Paraguay. 1921 reiste eine Gruppe nach Quebek, von dort mit dem Schiff zum La Plata und dann den Parana aufwärts nach Paraguay. Im Niemandsland der noch unbestimmten Grenze zu Bolivien sollten sie siedeln, und wurden zugleich als Spielball politischer Machtkämpfe und Intrigen genutzt. Für die Reise nach Mexiko charterten sie 36 Züge. Die brachten die Umsiedler mit all ihrer Habe, dem Vieh und den Ackergeräten, quer durch die USA von Nord nach Süd, in die Provinzen Chihuahua und Duranga. Dort hatten sie 3000 Quadratkilometer entlegenes Hochland von Großgrundbesitzern gepachtet. Das von ihnen verlassene Land aber wurde kein Ödland, wie sie der Regierung gedroht hatten, sondern wurde nahtlos von den Neueinwanderern aus Rußland übernommen. *** Das Leben der 6000 nach Mexiko ausgewanderten Mennoniten stand dann rückblickend unter keinem guten Stern. In Westpreußen, Rußland und Kanada hatten sie nahezu jungfräuliche Erde kultiviert und danach ertragreich geerntet. Hier war das Hochland steinig, ausgewaschen, versalzen und bisher gerade als dürftiges Weideland genutzt worden. Nur in den Senken und Tälern war es als Ackerland zu nutzen. Doch die Sommer waren trocken und heiß, um Erträge zu ernten, mußte es regelmäßig bewässert werden. Aber auch sonst gab es für die Siedler viele Probleme. Das Hochlandklima war ihnen nicht vertraut. Es gab keine strengen Winter und nur wenige Tage im Jahr an denen das Thermometer tagsüber um den Gefrierpunkt pendelte. Das war ein Vorteil, das Vieh konnte das ganze Jahr im Freien leben und brauchte keine Ställe. Doch es gab vom frühen Herbst bis in das späte Frühjahr Nachtfröste — eine Gefahr für frühe Saaten und späte Ernten. Auch ihre mitgebrachten Pferde waren für das Hochland zu schwer und zu teuer im Unterhalt und ihre mitgebrachten Ackergeräte waren hier auf dem steinigen Boden kaum zu gebrauchen. Das alles übersahen die Neusiedler in Chihuahua. Sie bauten auf ihre Erfahrungen und mußten Lehrgeld zahlen. Als nachteilig erwies sich auch, daß das anfangs gepachtete Areal größer war, als sie bewirtschaften konnten. Doch die Pacht mußte für das gesamte Gebiet gezahlt werden. Mißernten kamen hinzu und Bankpleiten, raubten ihnen große Teile ihres ersparten Kapitals. Ganze Dörfer, die als Gesamtschuldner für die Pacht und sonstige Abgaben hafteten gingen Pleite. In Duranga hingegen hatten die Neusiedler eine bessere Führung. Sie erkannte sehr schnell, daß sie von den Einheimischen lernen müssen, um das Land erfolgreich zu bewirtschaften. Diese Einsicht ersparte den Siedlern dann auch größere Mißerfolge. Als günstig erwies sich auch, daß sie schon früh mit der Käseproduktion begonnen hatten. Doch, als hätten sie noch nicht genug Sorgen und Nöte, um das Dasein mit all seinen Widrigkeiten zu bestehen, kam zu allem Überfluß auch noch ein ständiger Streit der Siedler untereinander hinzu. Als sich die Bauern in Chihuahua Pumpen anschaffen wollten, um das Land zu bewässern, waren die Prediger dagegen. Sie sagten: 'Der Mensch solle nicht durch Maßnahmen irdische Güter erstreben, die er sonst nicht erhalten hätte.' In Duranga hatten sie mit ihrer Käseproduktion erfolg. Nur die Märkte, auf denen sie ihre Waren verkaufen konnten, waren mit Pferdefuhrwerken nicht zu erreichen. Die Anschaffung von Autos aber lehnten die Prediger ab. So übernahmen Mexikaner die lukrativen Transporte. Als die Bauern Trecker anschaffen wollten, um das Land besser bewirtschaften zu können, sahen die Ältermänner und Prediger darin einen Verstoß gegen ein gottgefälliges Leben. Als sie schließlich dem Druck der Bauern nachgeben mußten, durften die Traktoren nur eiserne Reifen mit großen Zacken haben. Doch die Bauern wollten Gummireifen sie waren angenehmer und wirtschaftlicher. Der Streit dauerte viele Jahre und endete erst, als es keine Eisenräder mehr zu kaufen gab. Dann wieder stritten sie sich, ob sie die Elektrizität nutzen sollten
oder nicht. In dem einen Dorf wurde sie erlaubt, in dem anderen nicht.
So kam es, daß in den Häusern des einen Dorfes elektrisches
Licht brannte, während einige Dörfer weiter noch Kerzen und
Petroleumlampen Aber auch um belanglose Dinge wurde ernsthaft gestritten. So diskutierten sie in einigen Kolonien lange, ob ihre Sprache nun Plattdüütsch oder Plautdietsch heißen sollte. *** Waren anfangs auch die Wirtschaftsflächen größer als sie bearbeiten konnten, so wurde auch in Mexiko der Lebensraum schneller als erwartet eng und enger. Da es in Mexiko kaum noch geeignetes Siedlungsland zu kaufen gab, fanden sie es in Belize, Brasilien, Argentinien und Bolivien. Wie in früheren Zeiten gingen wieder einmal erster Linie die Altkolonisten auf die Reise in die meist entlegenen, kaum kultivierten Gebiete Südamerikas. Und mit ihnen wanderten die Grundsätze Ihres Glaubens, ihre eigenen Schulen und Kirchen, die entsagende Lebensweise und ihr Plautdietsch, als bewährtes Bollwerk, gegen die Einflüsse anders denkender Menschen. *** Von den in Mexiko verbliebenen Mennoniten berichtete 1955 eine Krankenschwester
aus Chihuahua. Viele Dörfer glichen heute Elendsquartiere. Mit der
Armut sei auch die Moral gesunken. Die Leute ließen sich gehen,
die Trunksucht nähme zu. Nicht selten, daß junge Mädchen
volltrunken in das Hospital gebracht würden. Als 1972 einige Schulen, gegen den Willen der Ältermänner, dem staatlichen System angepaßt wurden, hätten sie gezetert: Bildung und Kultur seien weltlich, und Plautdietsch sei ihre Sprache. Wer in ihre Kirche gehe, der solle seine Kinder auch auf eine altkolonistische Schule schicken. *** Betrachtet man die Wanderung der Mennoniten, kann man ihre Geschichte
mit einem immer schneller drehenden Rad vergleichen. In Westpreußen
hatten sie 250 Jahre, in Rußland 100 Jahre, in Kanada gerade 40
Jahre gelebt, bis die jeweiligen Regierungen die verliehenen Rechte der
Religionsfreiheit und die Befreiung von der Wehrpflicht für ungültig
erklärten. Die 500 Jahre lange Wanderung der Altkolonisten war dornig und ein ständiges
Neuanfangen. Für jeden Neubeginn aber galt: Den Alten der Tod, den
Kindern die Not und den Enkeln das Brot. Zu Hause sprachen wir nur Plautdietsch, erst in der Schule habe ich englisch
gelernt.' *** Trotz der ständigen Erosionen und das Bestreben der Gastländer die Siedler als Staatsbürger mit allen Pflichten einzubürgern, haben sich in Mittel und Südamerika bis in unsere Zeit mennonitische Kolonien erhalten, die noch immer nach den alten Grundsätzen des Glaubens ihre Tage fristen. Nach einem Bericht von Kathrina Nikoleit aus dem Jahre 2003 leben in der Kolonie ‚Nuevo Esperanza' (Neue Hoffnung) in Bolivien ca 25000 Mennoniten. Ihre Umgangssprache ist ein Altplattdeutsch. In den Schulen und Kirchen sprechen sie ein Althochdeutsch. Nur wenige Männer, die leidlich spanisch sprechen, regeln das Nötige mit der Außenwelt, wie den Verkauf der eigenen Produkte und den notwendigen Einkauf von Waren die sie nicht selbst herstellen, wie Kleiderstoffe Näh- und Haushaltsartikel, Kaffee und Salz. Das Land, das sie bewirtschaften ist fruchtbar. Als Viehzüchter haben sie einen guten Ruf, und ihr Käse ist begehrt. Die Reifen der Traktoren aber sind mit Noppen versehen, damit sie nicht zu Spazierfahrten benutzt werden können. Lebensfreude, Tanz und Musik sind verpönt. Das abgekapselte Leben zeigt aber auch seine Schattenseiten. Viele Gesichter deuten eindeutig auf geistige Behinderungen. Sehr überrascht war Professor William D. Keel aus Kansas City, der die verbliebenen Sprachreste der plattdeutschen Einwanderer im mittl. Westen erforscht, als um 1990 herum 3000 mennonitische Familien aus Mexiko auftauchten, die nur ihr plautdietsch sprachen. Von der Not getrieben hatten die Männer dort im südwestlichen Kansas Arbeit auf den Schlachthöfen angenommen, die kein Amerikaner machen wollte. Die Lehrer in den Schulen aber standen vor dem Problem 9000 Kinder, die nur plautdietsch sprachen, zu unterrichten. Heute, so schätzt man, leben weltweit ca. 1 Mio Mennoniten. Die meisten auf dem Doppelkontinent. 100000 leben in Europa, vor allem in Deutschland und Holland. Von den in Europa lebenden soll noch jeder Zweite Plautdietsch verstehen, und von den, in den letzten Jahren aus Rußland zurückgekehrten, spricht, so wird vermutet, nur noch jeder 10. diese Sprache. Reine plautdietsche Sprachinseln aber gibt es weltweit nur noch wenige. *** Wie das Plattdeutsche in Norddeutschland, haben sich auch im Plautdietschen
im Laufe der Zeit verschiedene Mundarten entwickelt. *** Aus der Sicht des Wohlstandsbürgers fällt es schwer, das starrköpfige
beharren der Altkolonisten, mit ihren längst überholten Lebensformen
und den starren Dogmen, zu verstehen. Aber es betrübt auch, wenn
man an der Geschichte dieser Menschen erkennen muß, daß es
für friedfertige Christen, die keine Waffen tragen und keine Eide
schwören wollen, kaum noch einen Flecken Erde in dieser Welt gibt,
auf dem sie unbehelligt leben können. Mit dem gleichen Atemzug stellt sich aber auch die Frage: Sind die Gedanken dieser Menschen wirklich so abwegig, daß wir nur ein müdes Lächeln dafür übrig haben dürfen? Betrachten wir unser eigenes Tun durch eine kritische Lupe so entdecken
wir schnell ein anderes Extrem. Wir vergöttern den Wohlstand. Das
Auto ist unser liebstes Kind, und die Werbung der freien Machtwirtschaft
läßt uns glauben, je größer das Auto, um so wertvoller
der Mensch, der es fährt. Das gleiche gilt für gehobene Markenwaren
der Bekleidungsindustrie. |
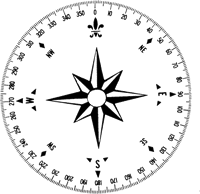 |